Pronstorf/03. Geschichte der Anlage vor dem 18. Jahrhundert
| leave blank, so we can add automated content later | 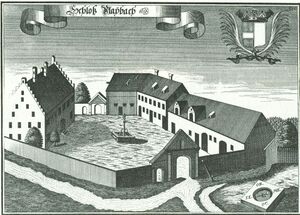
|
SekundärliteraturIn der wichtigsten zeitgenössischen Publikation mit Ansichten von Schwedens Schlössern und Herrenhäusern vor allem des 17. Jahrhunderts, Erik Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna [...],[1] ist Stola nicht verzeichnet, vielleicht weil der Neubau des Herrenhauses im Jahr der Publikation des Kupferstichwerks noch nicht fertiggestellt war.[2] Aufgrund der Bedeutung der Besitzerfamilie Ekeblad wird die Gutsanlage von Stola jedoch schon früh im 19. Jahrhundert in historisch-genealogischen oder landeskundlichen Publikationen erwähnt – etwa in Jonas Friedrichsson Mellins Minne öfver Claes Julius Ekeblad (Zum Gedenken an Claes Julius Ekeblad)[3] oder Erik Tunelds Geografi öfver konungariket Sverige (Geographie des Königreichs Schweden).[4] Aus dem landeskundlichen Werk Claes Johan Ljungströms Kinnefjerdings och Kållands härader samt staden Lidköping ([Die Regionen] Kinnefjerding und Kålland sowie die Stadt Lidköping) geht das Datum der vermutlich ersten schriftlichen Erwähnung Stolas im Jahr 1129 hervor,[5] als Simon Pedersson (belegt im 12. Jahrhundert) im Besitz des Gutshofs war.[6] Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist es wohl erneut das Interesse an der Familie Ekeblad, das Nils Erdmann dazu bewog, sich in seinem Ur rococons lif , typer och seder (Aus dem Leben des Rokokos: Bräuche und Sitten)[7] auf mehr als 200 Seiten mit dem Leben und der Person Claes Julius Ekeblads d.J. (1708–1771) zu beschäftigen. Wenig später gab Nils Sjöberg die Briefe von dessen Großvater Johann Ekeblad (1629–1697) heraus.[8] Der Familie und einzelnen Mitgliedern sind ebenfalls Einträge im Svenskt Biografiskt Lexikon (Schwedisches Biographisches Lexikon)[9] gewidmet. Das anhaltende Interesse an der Familie Ekeblad und Stola belegt die 2016 publizierte Schrift Ekebladarna på Stola (Die Ekeblads auf Stola).[10] Zu Beginn des 20. Jahrhunderts beginnt eine erste systematische Beschäftigung der (kunst-) historischen Forschung mit schwedischen Gutsanlagen: So wird in der mehrbändigen Publikation der Svenska slott och herresäten im 1910 erschienenen Band zu Västergötland vom Bearbeiter Axel L. Romdahl das Herrenhaus in Stola zwar kurz beschrieben, doch vor allem auf die Besitzenden eingegangen.[11] Zu der Zeit bildete die historisch genealogische Forschung im Bezug auf die Familiengeschichte nach wie vor einen wichtigen Schwerpunkt,[12] allerdings rückten allmählich auch kunsthistorische Fragen stärker in den Fokus des Interesses: So veröffentlichte Otto Mannerfelt 1923 einen Aufsatz über die Ekeblads und ihre Sammlungen in Stola[13] und im von Sigurd Erixon und Sigurd Wallin herausgegebenen Band über Västgötagårdar, herremännens och böndernas äldre byggnadskultur i Skaraborgs län (Västergötländische Herrenhäuser, die ältere Baukultur der Herren und Bauern im Kreis Skaraborg)[14] wird beispielsweise die Frage nach dem Entwerfer des Herrenhauses in Stola gestellt.[15] Besonders das 1940 von William Karlson kommentiert publizierte Inventar Claes Julius Ekeblads von Stola aus dem Jahr 1796 dokumentiert die Ausstattung des Baus am Ende des 18. Jahrhunderts[16] und stellt bis in die Gegenwart eine wesentliche Quelle dar. Das Herrenhaus Stola ist in der Folge in weiteren Überblickswerken verzeichnet: so in der von 1935 bis 1942 erschienenen 47-bändigen Reihe der Svenska gods och gårdar (Schwedische Güter und Gutshäuser) mit einem sehr kurzen Eintrag im Band über Västergötland.[17] Im ebenfalls mehrbängigen Überblickswerk Slott och herresäten i Sverige (Schlösser und Herrenhäuser in Schweden)[18] summiert der 1968 von Lennart Luthander herausgegebenen Band zu Västergötland im Eintrag zu Stola die bisherigen Erkenntnisse zum Herrenhaus – leider ohne Belegstellen.[19] Dieses Versäumnis holt der grundlegende Artikel Barbro Westrins Stola säteri (Das Herrenhaus Stola) in der Reihe über denkmalgeschützte Bauten in der Region Skaraborg aus dem Jahr 1986 nach.[20] Übergeordnete Publikationen zur schwedischen Architektur- und Ausstattungsgeschichte von Herrenhäusern und Schlössern liefern nach dem 1937 publizierten (und in den 1990er Jahren neu aufgelegten) Grundlagenwerk Gösta Sellings[21] unter anderem Fredric Bedoire und Lars Sjöberg.[22] Sie gehen verstärkt kunsthistorischen Fragestellungen in Bezug auf Herrenhäuser nach. Dadurch vertiefen sich generell die Kenntnisse über die schwedischen Herrensitze, selbst wenn Stola in diesen Publikationen nur gelegentlich erwähnt wird.[23] Das trifft weitgehend auch auf die zahlreichen vergleichenden Untersuchungen des Wirtschaftshistorikers Göran Ulväng über schwedische Herrenhäuser zu,[24] doch in seiner auf Vollständigkeit angelegten Datenbank Svenska Herrgarda (Schwedische Herrenhäuser),[25] findet sich Stola mit einer vollständigen Besitzergeschichte seit der Mitte des 15. Jahrhunderts.[26] Auch in Arbeiten über Carl Hårleman als einem der führenden Architekten des 18. Jahrhunderts nehmen dessen Innenraum-Entwürfe für Stola kaum Raum ein.[27] Hingegen konnte Barbro Westrin in seinem kurzen Aufsatz über einen nicht ausgeführten Entwurf des Architekten Carl Fredrik Adelcrantz’ für ein Gästehaus in Stola ein interessantes Detail der Planungsgeschichte aufdecken [Westrin 2004].[28] Sten Karling hatte einige Jahre zuvor bereits eine Carl Hårleman und Jean Eric Rehn (1717–1793) als Zeichner zugeschriebene Zeichnung aus der Mitte des 18. Jahrhunderts mit einem Vorschlag für eine nicht oder nur zu geringen Teilen ausgeführte Garten- und Parkgestaltung in Stola veröffentlicht [1M16-D9483].[29] Im Jahr 2014 entstand eine Bachlorarbeit am Institut für Kulturerbe der Universität Göteborg, welche die Bedeutung des erhaltenen englischen Gartenteils und die Pflege des Gedenkhains in Stola untersucht hat.[30] Die von Westrin kontinuierlich publizierten weiteren Aufsätze Stola betreffend, spiegeln die für die heutige Zeit typische Tendenz zu punktuell vertiefter Forschung über einzelne Herrenhäuser.[31] Zunehmend weckt das neuere Thema der Restaurierungsgeschichte und der damit zum Teil verbundenen Musealisierung verschiedener Herrenhäuser das Interesse der Forschung.[32] Der 2010 zu diesem Aspekt von Robin Gullbrandsson veröffentlichte Aufsatz über Stola hinterfragt die vom Restaurator Alfred Nilson[33] (1888–1953) und dem historisch interessierten Architekten Erik Lundberg[34] (1895–1969) Mitte des 20. Jahrhunderts durchgeführte Instandsetzung und Restaurierung des Herrenhauses in Stola kritisch.[35] Neben wissenschaftlichen Publikationen wurde das Herrenhaus Stola vermutlich wegen der erhaltenen bzw. gut restaurierten (und damit fotogenen) Innenausstattung des 18. Jahrhunderts verschiedentlich in teils internationale Bildbände über schwedische Herrenhäuser aufgenommen.[36] Bei diesen Publikationen fehlt ein wissenschaftlicher Anspruch (z.B. keine Quellennachweise) und aufgrund des häufig geringen Textanteils enthalten diese Bücher in der Regel keine neuen Erkenntnisse über das Herrenhaus. Für das abseits im ländlichen Schweden gelegene Stola erreichen diese Bände mit atmosphärischen Fotografien zumindest den Bekanntheitsgrad, der diesem aus dem 18. Jahrhundert weitgehend unverändert erhaltenen Herrenhaus gebührt. ArchivalienDie historisch-genealogische (aber auch kunsthistorische) Forschung hat vielfach vor allem Quellen im Bezug auf die Familie Ekeblad als Besitzer von Stola erschlossen.[37] Alle Autoren sind sich jedoch einig, wie sehr das Herrenhaus in Stola als Stammsitz der Familie Ekeblad die Ambitionen und Lebensweise der Besitzerfamilie widerspiegelt.[38] Es bestehe eine so enge Verbindung, dass der eine Name nicht genannt werden könne, ohne zwangsläufig den anderen Namen in Erinnerung zu rufen.[39] Am umfänglichsten hat bislang Karlson verfügbare Schriftquellen und Objekte aus Stola erforscht:[40] Im ersten Drittel der Publikation werden die vorhanden Quellen und bekannten Archivalien zu Stola umfänglich ausgewertet und im Text wie den Anmerkungen darüber hinaus teilweise transkribiert. Im Buch folgt dann das kommentiert publizierte Inventar Claes Julius Ekeblads von Stola aus dem Jahr 1796. Abschließend zeichnet Karlson noch den Weg einzelner Objekte des Ekeblad-Erbes aus Stola bis ins Jahr 1940 nach.[41] Westrin nennt in seinem Aufsatz 1986 unpublizierte Archivalien zu Stola und den Ekeblad im Riksarkivet[42] (Reichsarchiv), in der Kungliga Bibliotheket[43] (Königlichen Bibliothek), im Nordiska Museet[44] (Nordischen Museum) jeweils in Stockholm und zählt kleinere Bestände in anderen Archiven auf.[45] Weitere Archivalien zu Stola befinden sich in der De la Gardie-Sammlung in der Universitätsbibliothek in Lund – u.a. das Inventar von 1796[46] [DLG 1]. Vermessungskarten von Stola aus dem 18. Jahrhundert [Stola1728+(2)] sind im Bestand der Lantmäteriet, Rikets allmänna kartverks archives[47] (Landvermessung und Nationales Allgemeines Kartographisches Archiv) vorhanden.[48] Zuletzt benannte Gullbrandsson für seine denkmalpflegerischen Fragen 2010 unpublizierte Quellen zu Stola in folgenden Archiven:[49] Antikvarisk-topografiska arkivet[50] (ATA, Das antiquarisch-topographische Archiv) in Stockholm, Alfred Nilsons arkiv (Alfred Nilsons Archiv) und Erik Lundbergs ritningsarkiv (Erik Lundbergs Zeichnungsarchiv) beide im Arkitekturmuseet[51] (Architekturmuseum) in Stockholm, Västergötlands museums arkiv[52] (Archiv des Museums Västergötland) in Skara und das Gutsarchiv in Stola. [1] Vgl. https://suecia.kb.se/F/?func=find-b&local_base=sah (01.11.2023); https://www.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?pid=alvin-record%3A80130&dswid=4154 (09.02.2024) und Suecia Antiqua et Hodierna 1716. Das Werk enthält vor allem Ansichten von Schlössern und Herrenhäusern aus dem späten 17. Jahrhundert bis etwas nach der Jahrhundertwende. [2] Der Vorgängerbau in Stola war vermutlich nicht neu und repräsentativ genug, um aufgenommen zu werden. [3] Vgl. Mellin 1813. [4] Vgl. Tuneld 1833. [5] Vgl. Ljungström 1871, S. 74. [6] Vgl. Hildebrand 1949a, https://sok.riksarkivet.se/sbl/Mobil/Artikel/16801 (26.01.2023). [7] Vgl. Erdmann 1901. [8] Vgl. Sjöberg 1911–1915. [9] Vgl. Hildebrand 1949a, https://sok.riksarkivet.se/sbl/Mobil/Artikel/16801 (26.01.2023). [10] Vgl. Allén/Frängsmyr 2016. [11] Vgl. Svenska slott och herresäten 1908–1923. Stola in: Bd. Västergötland, Halland, Värmland, Nerike, Västermanland, S. 28–32 = Romdahl 1910. [12] Vgl. Elgenstierna 1926 mit genealogischen Tafeln des schwedischen Adels, Erdman 1926 mit Quellenveröffentlichungen über den Hof und auf adligen Gütern im Schweden des 18. Jahrhunderts. [13] Vgl. Mannerfelt 1923. [14] Vgl. Erixon/Wallin 1932. [15] Vgl. Erixon/Wallin 1932, S. 66 zitieren den Schreiber Erik Andren, der behauptet, der lokale Baumeister Håkan Eliander sei der Entwerfer Stolas. [16] Vgl. Karlson 1940. Das Original des Inventars befindet sich in der Universitätsbibliothek Lund, De la Gardieska arkivet, Topographica, Västergötland, Stola 1c. [17] Vgl. Svenska gods och gårdar 1935–1942, Stola in Bd. 30, Västergötland Skaraborgs län (västra), Uddevalla 1942, S. 892. [18] Vgl. Slott och herresäten i Sverige 1966–1971, Stola in Bd. 10, Teil 1 Västergötland: Almnäs–Stola, Stockholm 1968, S. 411–435 = Luthander 1968. [19] Vgl. Luthander 1968, S. 411–435. [20] Vgl. Westrin 1986. [21] Vgl. Selling 1937 (1991). [22] Vgl. Sjöberg 2000, Bedoire 2001, Bedoire 2015. [23] Vgl. etwa Bedoire 2001, Bedoire 2015. [24] Vgl. etwa Ulväng 2017. [25] Vgl. https://www.svenskaherrgardar.se/ (10.11.2022). [26] Vgl. https://www.svenskaherrgardar.se/herrgardsdatabasen/gard/10693 (10.11.2022). [27] Vgl. u.a. Alm 2000 mit lediglich einem Hinweis auf Stola, S. 308. [28] Vgl. Westrin 2004. Zeichnung befand sich 2004 in der Restaurierungswerkstatt im Regionalarchiv Göteborg und wurde dem Nationalarchiv in Göteborg am 31.03.2005 unrestauriert zurückgegeben, vgl. e-Mail von Helena Mattisson 19.07.2023. [29] Vgl. Karling 1981, sowie https://digitaltmuseum.se/021017229956/1m16-d9483 (23.02.2023). [30] Vgl. Berglund 2014, quelle (27.03.2023). [31] Vgl. Westrin 1996, Westrin 1997, Westrin 2002. [32] Vgl. etwa Hellspong/Lindvall 2004, Geijer 2008 oder Edman 2008, u.a. S. 48 zu Stola. [33] Auch Nilsson. Vgl. https://www.wikidata.org/wiki/Q24019266 (22.02.2024); https://sok.riksarkivet.se/sbl/Mobil#/sbl/Mobil/Artikel/8922 (22.02.2024). [34] Vgl. Lundberg 1935, Lundberg 1942, Lundberg 1966, https://www.wikidata.org/wiki/Q5965758 (22.02.2024); https://sok.riksarkivet.se/sbl/Mobil#/sbl/Mobil/Artikel/9756 (22.02.2024). [35] Vgl. Gullbrandsson 2010. [36] Vgl. etwa Schermann 2010 oder Björkman 2016. [37] Zuletzt etwa Allén/Frängsmyr 2016. [38] Vgl. etwa Gullbrandsson 2010, S. 48. [39] Vgl. etwa Karlson 1940, S. 15 oder Gullbrandsson 2010, S. 47. [40] Vgl. Karlson 1940. Das Original des Inventars von 1796 befindet sich in der Universitätsbibliothek Lund, De la Gardieska arkivet, Topographica, Västergötland, Stola 1c. [41] Vgl. Karlson 1940, S. 155–180. [42] Vgl. Ekebladska samlingar, darin u.a. das Nachlassarchiv Eva Ekeblads von 1787, vgl. https://sok.riksarkivet.se/bouppteckningar?Efternamn=de+la+Gardie&Lan=Alla&AvanceradSok=False&page=5&postid=Bouppteckningar_799291EA-26F4-4C24-9FFD-00174A178F0E-48C480C1-F398-4EF0-9568-A7648F6B57BA&tab=post (02.03.2023); https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0105500_00047 (26.03.2024). [43] Kungliga Bibliotheket, Stockholm, Papiere zu Claes Julius Ekeblad: Journal. Papper rörande Stola [Aufzeichnungen. Papiere Stola betreffend] Signatur HSIe17a. [44] Vgl. Nordiska Museets Handlingar [Handreichungen des nordischen Museeums], lt. Westrin 1986, S. 59 zusammengestellt 1930/1931. [45] Vgl. Westrin 1986, S. 59. [46] Das Inventar befindet sich in der Universitätsbibliothek von Lund, De la Gardieska arkivet [De la Gardie Archiv], Topographica, Västergötland, Signatur: Stola 1c. [47] Vgl. https://www.wikidata.org/wiki/Q845497 (25.03.2024); https://www.lantmateriet.se (25.03.2024). [48] Karten von 1728, Geometrische Vermessung des Gutshofs Stola (Gemeinde Strö, Stola Nr. 1) von 1728, Lantmäteriet, Lantmäteristyrelsens arkiv, akt P195-7:1 und Geometrische Vermessung des Gutshofs Stola (Gemeinde Strö, Stola Nr. 2) von 1728. [49] Vgl. Gullbrandsson 2010, S. 63. [50] Vgl. https://www.wikidata.org/wiki/Q10413471 (22.02.2024); https://www.raa.se/tag/antikvariska-topografiska-arkivet-ata/ (22.02.2024). [51] Vgl. https://www.wikidata.org/wiki/Q4356728 (22.02.2024); https://arkdes.se (22.02.2024). [52] Vgl. https://www.wikidata.org/wiki/Q489175 (22.02.2024); https://vastergotlandsmuseum.se (22.02.2024). |
 
|
xxuse space for extra, visualizations, or 3D scan iframes. |
 
|
Einzelnachweise
| |
| leave blank, so we can add automated content later | 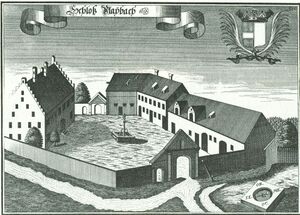
|
|
Bereits 1307 wurde ein Rittersitz, ein sogenanntes castrum , in Pronstorf nachgewiesen, der auf einer Motte lag. Diese befand sich am Rande des Dorfes und entstand an einem Platz, der nach Münzfunden vermutlich schon seit Mitte des 11. Jahrhunderts besiedelt war.[1] Bei den Untersuchungen durch das Vienna Institut for Archeological Science (VIAS) und die Geosphere Austria wurden bei der Messkampagne des Herrenhauszentrums im Januar 2023 Mottenanlagen am Rande von Pronstorf entdeckt (Abb. 3,4). Die Ritter von Pronstorf standen in einem Lehnsverhältnis zum Landesherren, die Bauern hingegen zu ihrem örtlichen Ritter. Jeder „Zehnte Teil“ und Naturalabgaben mussten geleistet werden, um den Schutz der Dorfbewohner von Pronstorf zu gewährleisten.[2] Ebenso waren die Ritter Schutzherren der Kirche von Pronstorf und übten das bis heute bestehende Patronatsrecht aus.[3] Gut Pronstorf wurde seit dem 13. Jahrhundert bis 1887, mit nur zwei Unterbrechungen, von der Familie von Buchwaldt (früher Bokwoldt) geführt. In einer Zeitspanne von vierzig Jahren besaßen zwei dänische Könige und die Familie von Ahlefeldt das Gut. 1464 kaufteChristian I. von Dänemark (1426 -1481) Pronstorf von seinem „Rath“ Bertram von Bokwoldt und gab den Besitz 1495 an seinen Sohn König Johann von Dänemark (1455 -1513) weiter, bis dieser ihn als königliches Lehensgut an Hinrich von Ahlefeldt (s.a.) verpachtete. Unmengen an Prozessen und Rechtstreitigkeiten um Weiden, Besitztümer, Bedienstete und Erbstreitigkeiten unter den Familienmitgliedern wurden ab dem 15. Jahrhundert dokumentiert. Im Jahr 1534 fielen schließlich die Lübecker während der sogenannten „Grafenfehde“ [4]auch in Pronstorf ein.[5] Der katholische Bischof von Lübeck, Heinrich Bockholt (1463–1535), wurde durch einen Aufstand zusammen mit der evangelischen Geistlichkeit aus der Stadt vertrieben. In den Jahren 1534 oder 1535 löste sich das Kirchspiel Pronstorf vom katholischen Bistum Lübeck ab und wurde protestantisch. Die künftigen Pfarrer bezahlte nun der Kirchenpatron und Besitzer Pronstorfs.[6] Im Jahr 1605 brannte das Pfarrhaus des Gutsdorfes ab, wurde jedoch zeitnah wieder aufgebaut.[7] Während des Dreißigjährigen Krieges wurde das Gut größtenteils zerstört und geplündert; 1643 brannten die Schweden die Gutsanlage bis auf das Herrenhaus komplett nieder. Dieses ursprüngliche „alte“ Herrenhaus lag nordwestlich des heutigen Herrenhauses und hatte zwei Stockwerke und einen Turm, schreibt Carl-Heinrich Seebach in seinem Buch über Pronstorf basierend auf Quellen des Gutsarchivs.[8] Nach dem Einzug der kaiserlichen Truppen unter Wallenstein und Tilly in Holstein wurde Pronstorf im Spätsommer 1627 konfisziert und 1628 schwer verwüstet. Die Familie von Joachim von Bockwoldt floh nach Lübeck und die Leibeigenen verließen Pronstorf aufgrund von Hunger, Bränden, Vergewaltigungen und Krankheiten. Die Felder lagen brach und das Dorf wurde nicht mehr bewirtschaftet. 1643[9] brannte schließlich der Gutshof mit seinen Wirtschaftsgebäuden vollständig ab, wobei das Herrenhaus stark beschädigt wurde. Bis 1645 war Pronstorf außerdem von den Schweden besetzt. Die Gebäude wurden erst von 1647 bis 1654 wieder errichtet und die übriggebliebenen Gebäude notdürftig instandgehalten. Ab 1653 wurde mit dem Wiederaufbau des Kirchturms begonnen und 1656 in der Kirche der neue Altar geweiht. 1657 fielen die Schweden jedoch erneut in Pronstorf ein. Wieder litt Pronstorf unter dem Krieg; ein Teil der Einwohner wurde vertrieben. Das Amtmann-Haus wurde zu einem Proviantlager der Schweden umfunktioniert und die Pronstorfer mussten hohe steuerliche Abgaben leisten. Nach Kriegsende beehrte 1675 der neue Herrscher König Christian V.von Dänemark und Norwegen (1646–1699) Joachim von Buchwaldt in Pronstorf und besuchte das „alte“ Herrenhaus, welches aus dem 15. oder Anfang des 16. Jahrhunderts stammte.[10] Am 26. November 1688 nahm Henning von Buchwaldt (1632–1717) nach dem Tode von Magdalena von Buchwaldt durch zwei Notare ein bis heute existierendes Inventar auf, welches sich im Gutsarchiv befindet. Dort wurden die Räume des „alten“ Herrenhauses wie folgt beschrieben: „Da ist zunächst die Hausdiele mit einem eichenen Ausziehtische, Bänken und vielen Stühlen, welche letztere zum Theil aus anderen Räumen hergestellt waren; auch die bescheidene Büchersammlung wurde hier verwahrt: Andachtsbücher und Postillen mit schwülstigen Titeln bildeten den Inhalt, sowie eine plattdeutsche Bibel…An die Hausdiele, welche nach dem Verzeichnisse der Truhen und Sitzgelegenheiten, die dort ein Unterkommen fanden, ein größerer Raum gewesen sein muss, stieß die vermutlich gelb-weiße ‚Cammer‘. Hier befand sich zunächst, wie in allen als ‚Cammer‘ bezeichneten Räume, eine ‚Bettstede‘, dann aber in Truhen und ‚Schappen‘ bares Geld, Obligationen, ‚Documente‘, Silber- und Leinenzeug und Betten. – Die zunächst inventarisierte große Stube enthielt nur einen geringen Inhalt und wurde wohl als Wohn- und Speiseraum genutzt. Die kleine Speisekammer enthielt einiges ‚Geräthe‘. Dann folgt unten die ‚Cammer‘ mit grün und weißen Tapeten bezogen, auch mit ‚Bettstede‘. Negst der obigen ‚Cammer‘ im ‚Cabinet‘ verwahrte man die den Trauerschmuck des Hauses an Leichenlaken, Sargschmuck und damals gebräuchlichen Traueremblemen auf, auch ein Kruzifix, verschiedene Andachtsbücher und viele ‚Documente‘ in Truhen und Schränken hatten hier Platz. Diese ‚Documente‘ bestanden zum Theil in für das Gut wichtigen Grenzverträgen mit Nachbarn und wurden hier auch die Kirchenrechnungsbücher verwahrt. Die lange Stube hatte nur geringen Inhalt: einen Eichentisch mit schwarzseidener Tischdecke mit seidenen Fransen und zwei weißleinen Fenstergardinen; dieser Raume diente wahrscheinlich als Wohnzimmer. In der weißen Kammer wird ein Frauentisch und eine ‚Frauenbettstede‘ erwähnt, vermutlich das Schlafzimmer der Hausherrin. Ein Raum im Frauenhause‘ (Frauentrakt) benannt, jedenfalls die Spinnstube, wo die ‚Dirnen‘ unter Aufsicht der Hausfrau spannen und webten.“[11] Diese Kammern bezeichnen den ersten Stock des Hauses. „Die ‚Cammer‘ oben bei dem Turm, wo sich eine Bettstadt befand, und viele Betten aufbewahrt wurden“. Ebenfalls oben belegt wird die ‚alte Schuel‘, in der noch ein leeres ‚Bücher-Repositorium‘ an die einstige Bestimmung, hier die ‚Junker‘ und ‚hochadeligen Jungfern‘ zu unterrichten, erinnerte. Ferner lag im oberen Stock die ‚Kleyder-Cammer‘ auch mit Bettstede. Auf dem „Bohden“ wurden in Truhe und Kisten viel Leinenzeug, Kleidungsstücke und Plunder jeglicher Art verwahrt, auch 19 alte ‚Conterfeiten‘ und 6 ‚allerhand Schildereyen‘ ohne Rahm auch 33 Stück Groß und Klein wollen, auf Leinen gemacht so zu der ‚gelben Cammer‘ gehören. Die ‚Thurm-Cammer‘ enthielt 1 ‚Conterfeit‘ und 1 alt Gemälde […]. Die Garderobe des Hausherrn scheint hier aufbewahrt worden zu sein. Der ‚Bohden‘ über der ‚Cammer‘ enthielt Betten. – Das Dach wird nach den beiden Böden zu urteilen, ein geteiltes gewesen sein. Noch werden noch genannt die ‚Fleisch-Cammer‘ und die ‚Bolts-Cammer‘ (?), letztere viele Betten enthaltend. Die Küche war am reichsten ausgestattet. Eisengeräte, Zinn-, Englisch-Zinn-, Messing- und Kupfergeschirr, 23 zinnerne Schüsseln und 41 zinnerne Teller bildeten das ‚Tischgerät‘ […].“[12] Diese Beschreibung über die Organisation des adeligen Haushalts und die Nutzung der Räume vermittelt einen Eindruck über das Wohnen der Adelsfamilie in einem Herrenhaus. Pronstorf war weiterhin bis ins 17. Jahrhundert ein Lehensgut mit allodialem[13] (privatbesitzlichem) Charakter.[14] Nachdem das erste Herrenhaus des Gutes bei dem Brand schwer beschädigt wurde und nicht mehr bewohnbar war, entschloss man sich ab 1716 zu einem Neubau, der bis um 1730 fertiggestellt wurde.[15] Einige Objekte des Interieurs wurden in das neue Haus mit umgezogen, so auch die Unterlagen und Dokumente des Gutsarchivs. Historische Ereignisse in Schleswig-Holstein, die Pronstorf betreffenDurch die Kampfhandlungen der kaiserlichen Truppen und der Schweden während des Dreißigjährigen Krieges wurde der komplette Wirtschaftshof 1643 zerstört und Pronstorf durch Brandschatzung und Plünderung schwer verwüstet. Auch der Nordische Krieg (1700–1721) schadete Pronstorf erheblich, insbesondere im Jahr 1714, aufgrund hoher Abgaben in die Kriegskasse und der Einquartierung von Söldnertruppen. Während des Krieges wurden russische Soldaten im Nachbardorf Strukdorf einquartiert. Unter ihnen brach die Pest aus, die auch viele Bewohner: innen der Umgebung traf.[16] Einzelnachweise
xxuse space for extra, visualizations, or 3D scan iframes. |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|